
 |
Natürlich sind
Papier, Karton oder Pappe die wichtigsten Materialen, aus denen Papierflieger
bestehen. Darum soll es aber hier nicht gehen. Wenn wir hier über
Konstruktionsmaterialien für Papierflieger reden, handelt es sich um
zusätzliche Hilfsmittel, welche hautsächlich zur Formgebung und
Konditionierung des Fliegers eingesetzt werden. Andere Hilfsmittel, welche
dagegen ausschließlich zum Trimmen oder als Ballast zum Einstellen
der gewünschten Schwerpunktlage dienen, werden auf der Seite
<Trimmgewicht & Ballast> behandelt.
Es lassen sich zwei Gruppen von Konstruktionsmaterialien unterscheiden,
nämlich solche, welche am fertigen Flieger verbleiben und Hilfsmittel,
welche nach Anwendung wieder entfernt werden. Erstere kommen bei Oriplanen
nie, bei Faltfliegern eher selten und bei Papierflugzeugen häufig zum
Einsatz. Entfernbare Hilfsmittel können dagegen bei allen Spielarten
der Papierfliegerei Anwendung finden, werden aber von Außenstehenden
selten bemerkt (da sie im Flug nicht mehr am Flieger zu sehen sind).
Hilfmitteln beider Sorten sind in Anzahl und Anwendung kaum Grenzen gesetzt.
Deshalb wird die nachfolgende Aufzählung wohl immer unvollständig
sein. Vielleicht kann sie dir aber die eine oder andere Anregung zur Konstruktion
deiner eigenen Papierflieger vermitteln.
Einseitiges Klebeband gehört zu den am häufigsten gebrauchten Hilfsstoffen beim Bau von Faltfliegern, aber auch bei Papierflugzeugen findet es oft Verwendung. Es entstehen keine Zwangspausen für das Austrocknen, wie bei Klebstoffen auf Basis von Lösemitteln. Außerdem wird das Papier nicht feucht und so auch nicht in seinen Eigenschaften verändert.
 Am bekanntesten sind Kunststoffträger mit
Klebeschicht. Ob nun Markenprodukte wie Tesa-Film oder no name, es gibt sie
als großflächige Klebefolien oder auf Rollen in den verschiedensten
Abmessungen und Folienstärken. Am ehesten eignet sich jedoch, meiner
bescheidenen Meinung nach, ganz einfache Rollenware für's Büro.
Ich bevorzuge eine Breite von ca. 12,5 mm. Befindet sich die Klebebandrolle
in einem Tischspender, lassen sich beliebig viel und beliebig lange Stücke
mit nur einer Hand entnehmen. Die Zweite hat man dann für andere wichtige
Dinge frei, wie zum Beispiel die Klebestelle in Form zu halten. Leider haben
Klebestreifen mit Kunststoffrücken auch Nachteile.
Am bekanntesten sind Kunststoffträger mit
Klebeschicht. Ob nun Markenprodukte wie Tesa-Film oder no name, es gibt sie
als großflächige Klebefolien oder auf Rollen in den verschiedensten
Abmessungen und Folienstärken. Am ehesten eignet sich jedoch, meiner
bescheidenen Meinung nach, ganz einfache Rollenware für's Büro.
Ich bevorzuge eine Breite von ca. 12,5 mm. Befindet sich die Klebebandrolle
in einem Tischspender, lassen sich beliebig viel und beliebig lange Stücke
mit nur einer Hand entnehmen. Die Zweite hat man dann für andere wichtige
Dinge frei, wie zum Beispiel die Klebestelle in Form zu halten. Leider haben
Klebestreifen mit Kunststoffrücken auch Nachteile.
Zum einen versiegelt die Folie das Papier an der Klebestelle. Es kann dort
nicht mehr <atmen>, das heißt sich an die Luftfeuchtigkeit der
Umgebung anpassen. Da diese Versiegelung in der Regel nur auf einer Seite
des Papiers erfolgt, kommt es vor allem bei dünnen Papieren früher
oder später zu unschönen Verwerfungen um die Klebestelle herum.
Zum anderen haftet die Klebeschicht der Folie einfach viel zu gut am Papier.
Daraus resultieren enorme Probleme, wenn man sie wieder entfernen will.
Häufig reißt das Papier ein, oder Teile der Papieroberfläche
werden mitgerissen. Selbst wenn es gelingt, den Folienstreifen ohne Verletzungen
im Papier herunterzuziehen, ist das Papier an der ehemaligen Klebestelle
immer noch stark unter Spannung und wird leicht beulen. Wenn man also mit
Folienklebeband arbeitet, sollte man genau wissen was man tut. Spätere
Korrekturen sind jedenfalls sehr schwierig, bei manchen Papieren unmöglich.

 Außer
Kunststoff gibt es auch noch viele andere Grundmaterialien für
Klebebänder. Mein persönlicher Favorit ist ein sehr dünner
fast durchsichtiger weißer Filz. Das daraus hergestellte Pflaster wird
in Apotheken unter dem Namen Gothaplast-Vlies verkauft. Man bekommt es in
der Breite von 12,5 und 25 mm als 10 m Rolle. Leider muss man es
in der Regel vorbestellen und es ist auch alles andere als billig. Dafür
ist es luftdurchlässig und lässt sich problemlos wieder vom Papier
ablösen. Trotzdem besitzt dieses Klebeband ausgezeichnete Hafteigenschaften.
Der hohen Kosten wegen, verwenden ich es allerdings vorwiegend zum Bauen
und zur Veränderung/Verbesserung von Prototypen. Wenn man den kleinen
Steg auf der Innenseite der Rolle heraustrennt, passt diese in fast alle
handelsüblichen Tischspender. Bei mir steht immer je ein Spender Tesa
und Gothaplast auf dem Basteltisch.
Außer
Kunststoff gibt es auch noch viele andere Grundmaterialien für
Klebebänder. Mein persönlicher Favorit ist ein sehr dünner
fast durchsichtiger weißer Filz. Das daraus hergestellte Pflaster wird
in Apotheken unter dem Namen Gothaplast-Vlies verkauft. Man bekommt es in
der Breite von 12,5 und 25 mm als 10 m Rolle. Leider muss man es
in der Regel vorbestellen und es ist auch alles andere als billig. Dafür
ist es luftdurchlässig und lässt sich problemlos wieder vom Papier
ablösen. Trotzdem besitzt dieses Klebeband ausgezeichnete Hafteigenschaften.
Der hohen Kosten wegen, verwenden ich es allerdings vorwiegend zum Bauen
und zur Veränderung/Verbesserung von Prototypen. Wenn man den kleinen
Steg auf der Innenseite der Rolle heraustrennt, passt diese in fast alle
handelsüblichen Tischspender. Bei mir steht immer je ein Spender Tesa
und Gothaplast auf dem Basteltisch.
 Bei größeren Flugzeugen aus Pappe oder
sogar Wellpappe lassen sich auch Klebebänder aus Papier gut einsetzen.
Omas braunes Papierband ,mit wasserlöslicher Leimschicht, ist damit
allerdings nicht gemeint. Die angefeuchteten Klebestreifen weichen die Pappe
an, trocknen nur langsam und kleben auch nur sehr mangelhaft. Besser ist
Malerkrepp aus dem Baumarkt. Dabei darf es ruhig das billige (fast) glatte
Kreppband sein. Die meisten Sorten klebt aufgezeichnet und mit Schere und
Bastelmesser lässt es sich gut zuschneiden.
Bei größeren Flugzeugen aus Pappe oder
sogar Wellpappe lassen sich auch Klebebänder aus Papier gut einsetzen.
Omas braunes Papierband ,mit wasserlöslicher Leimschicht, ist damit
allerdings nicht gemeint. Die angefeuchteten Klebestreifen weichen die Pappe
an, trocknen nur langsam und kleben auch nur sehr mangelhaft. Besser ist
Malerkrepp aus dem Baumarkt. Dabei darf es ruhig das billige (fast) glatte
Kreppband sein. Die meisten Sorten klebt aufgezeichnet und mit Schere und
Bastelmesser lässt es sich gut zuschneiden.
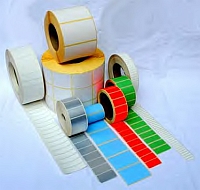 Selbstklebende Etiketten gibt es in vielen
Größen. Ob einfarbig oder bunt, beschriftbar, bereits beduckt,
aus Papier oder Metallfolie, alle lassen sich mehr oder weniger gut verarbeiten.
Der große Vorteil von Etiketten gegenüber einfachem Klebeband
besteht in den vielen absolut identischen Stücken. Mit Etiketten als
Verbindungsmaterial lassen sich schnell große Flotten identischer
Papierflugzeuge produzieren. Immer vorausgesetzt, du hast genug davon.
Natürlich sollte ein Entwurf, bevor er in Serie geht, bis auf's j-Kleckschen
ausgereift sein. Nicht zu unterschätzen sind auch die Designeffekte,
welche sich mit Etiketten erzielen lassen. Leider tragen diese nur selten
zur Verbesserung des Flugverhaltens bei.
Selbstklebende Etiketten gibt es in vielen
Größen. Ob einfarbig oder bunt, beschriftbar, bereits beduckt,
aus Papier oder Metallfolie, alle lassen sich mehr oder weniger gut verarbeiten.
Der große Vorteil von Etiketten gegenüber einfachem Klebeband
besteht in den vielen absolut identischen Stücken. Mit Etiketten als
Verbindungsmaterial lassen sich schnell große Flotten identischer
Papierflugzeuge produzieren. Immer vorausgesetzt, du hast genug davon.
Natürlich sollte ein Entwurf, bevor er in Serie geht, bis auf's j-Kleckschen
ausgereift sein. Nicht zu unterschätzen sind auch die Designeffekte,
welche sich mit Etiketten erzielen lassen. Leider tragen diese nur selten
zur Verbesserung des Flugverhaltens bei.
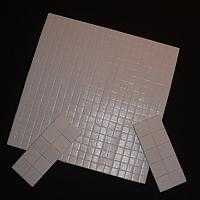
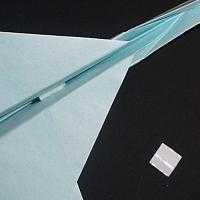 Doppelseitiges Klebeband eignet sich hervorragend
um den Rumpf eines Faltfliegers zu schließen oder um zusätzlichen
Ballast am Flieger zu befestigen. Je dünner das Band ist, desto weniger
wird es auffallen. Handelsüblich sind Rollen mit Meterware oder bereits
in kleine Quadrate zerteile Platten. Letztere, mit der sogenannten
3D-Colagetechnik (3D-Serviettentechnik) aufgekommen Zuschnitte, finde ich
besonderst praktisch. Es kann zwar manchmal etwas nervig sein die Schutzfolien
abzufummeln, vor allem wenn die Quadreate sehr klein sind, dafür lassen
sich die Klebestückchen aber meistens rückstandsfrei wieder entfernen.
Doppelseitiges Klebeband eignet sich hervorragend
um den Rumpf eines Faltfliegers zu schließen oder um zusätzlichen
Ballast am Flieger zu befestigen. Je dünner das Band ist, desto weniger
wird es auffallen. Handelsüblich sind Rollen mit Meterware oder bereits
in kleine Quadrate zerteile Platten. Letztere, mit der sogenannten
3D-Colagetechnik (3D-Serviettentechnik) aufgekommen Zuschnitte, finde ich
besonderst praktisch. Es kann zwar manchmal etwas nervig sein die Schutzfolien
abzufummeln, vor allem wenn die Quadreate sehr klein sind, dafür lassen
sich die Klebestückchen aber meistens rückstandsfrei wieder entfernen.
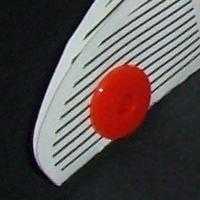
 Eine etwas ungewöhnliche Art, den Rumpf von Papierflugzeugen
dauerhaft zu schließen. Niete und Holniete wurden und werden
hauptsächlich bei industriell vorgefertigten Kartonfliegern verwendet.
Mit diesen Nieten wird manchmal auch gleich noch ein Ballastgewicht fixiert.
Beim Verwenden von Holnieten erhält man zusätzlich ausreißsichere
Löcher, welche sich ausgezeichnet zur Befestigung von Zugschnüren
oder als Buchse zur drehbaren Lagerung von Windspielen eignen. Trotzdem
gehören Nieten eher zu den exotischen Hilfsmitteln.
Eine etwas ungewöhnliche Art, den Rumpf von Papierflugzeugen
dauerhaft zu schließen. Niete und Holniete wurden und werden
hauptsächlich bei industriell vorgefertigten Kartonfliegern verwendet.
Mit diesen Nieten wird manchmal auch gleich noch ein Ballastgewicht fixiert.
Beim Verwenden von Holnieten erhält man zusätzlich ausreißsichere
Löcher, welche sich ausgezeichnet zur Befestigung von Zugschnüren
oder als Buchse zur drehbaren Lagerung von Windspielen eignen. Trotzdem
gehören Nieten eher zu den exotischen Hilfsmitteln.
 Heute
werden kaum noch Wahrenmuster mit der Briefpost verschickt. Der Musterbeutel
ist fast ausgestorben. Überlebt hat aber bis heute der Beutelverschluss,
die Musterbeutelklammer. Wir verdanken das der preiswerten Postversandart
<Büchersendung>. Außer Druckerzeugnisse darf die
Büchersendung nur einen Lieferschein oder eine sehr kurze Mitteilung
enthalten. Damit die Post das auch kontrollieren kann, muss man seine
Büchersendung in einem wiederverschließbaren Umschlag verschicken.
Das einfachste Mittel dazu ist bis heute die Musterbeutelklammer.
Heute
werden kaum noch Wahrenmuster mit der Briefpost verschickt. Der Musterbeutel
ist fast ausgestorben. Überlebt hat aber bis heute der Beutelverschluss,
die Musterbeutelklammer. Wir verdanken das der preiswerten Postversandart
<Büchersendung>. Außer Druckerzeugnisse darf die
Büchersendung nur einen Lieferschein oder eine sehr kurze Mitteilung
enthalten. Damit die Post das auch kontrollieren kann, muss man seine
Büchersendung in einem wiederverschließbaren Umschlag verschicken.
Das einfachste Mittel dazu ist bis heute die Musterbeutelklammer.
An Papierflugzeugen ist die Musterbeutelklammer allerdings noch exotischer als Niet oder Holniet. Wie diese wird die Musterbeutelklammer vor allem zum Verschluss der Rumpfspitze verwendet. Vorteil: Die benötigten Löcher lassen sich mit einem handelsüblichen Tischlocher stanzen.
 Heftklammern sind eine weitere Möglichkeit den Rumpf von
Papierfliegern zu verschließen. Die Anwendung ist allerdings etwas
problematisch, da sich das Papier beim Setzen der Heftklammer fast immer
verzieht. Ohne Korrektur wirkt sich das schnell auf die Flugleistung des
Fliegers aus.
Heftklammern sind eine weitere Möglichkeit den Rumpf von
Papierfliegern zu verschließen. Die Anwendung ist allerdings etwas
problematisch, da sich das Papier beim Setzen der Heftklammer fast immer
verzieht. Ohne Korrektur wirkt sich das schnell auf die Flugleistung des
Fliegers aus.
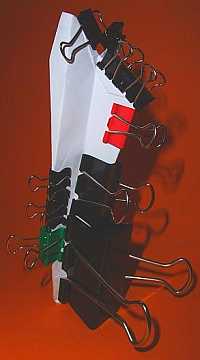 In Europa sind Foldback-Klammern ziemlich unbekannt.
Zudem wirst du diese speziellen Papierklammen wahrscheinlich nie an einem
fliegenden Modell sehen. Als Ballast sind sie zu leicht und zu sperrig, zum
Verschließen von Falten gibt es andere Möglichkeiten (siehe oben).
Dafür sind sie bei der Lagerung und Formgebung von Papierfliegern kaum
wegzudenken. Natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten um
Papierflugzeuge bis zum abtrocknen des Klebstoffes in Form zu halten, aber
kaum eine andere Klammer ist so präzise zu psitiomieren, so vielseitig
einzusetzen, so kräftig und dabei so preiswert. Die Stahldrahtbügel
an jeder Foldback-Klammer lassen sich übrigens nach dem Setzen der Klammer
leicht entfernen. So kann man sie noch dichter aneinander setzen.
Unterschiedliche Größen lassen sich sogar übereinander anordnen.
In Europa sind Foldback-Klammern ziemlich unbekannt.
Zudem wirst du diese speziellen Papierklammen wahrscheinlich nie an einem
fliegenden Modell sehen. Als Ballast sind sie zu leicht und zu sperrig, zum
Verschließen von Falten gibt es andere Möglichkeiten (siehe oben).
Dafür sind sie bei der Lagerung und Formgebung von Papierfliegern kaum
wegzudenken. Natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten um
Papierflugzeuge bis zum abtrocknen des Klebstoffes in Form zu halten, aber
kaum eine andere Klammer ist so präzise zu psitiomieren, so vielseitig
einzusetzen, so kräftig und dabei so preiswert. Die Stahldrahtbügel
an jeder Foldback-Klammer lassen sich übrigens nach dem Setzen der Klammer
leicht entfernen. So kann man sie noch dichter aneinander setzen.
Unterschiedliche Größen lassen sich sogar übereinander anordnen.
 Richtig interessant sind Foldback-Klammern allerdings
für die Lagerung von Hochleistungs-Faltfliegern. Beim Falten kommen
immer auch Spannungen ins Papier, welche dafür sorgen, das der Flieger
an den Falten wieder aufgehen möchte. Um diese Spannungen aus dem Papier
zu bekommen, sollten solche Flieger ca. eine Woche lang <nachreifen>.
In dieser Zeit bildet sich unter dem Einfluss von Druck, Temperatur und
Luftfeuchtigkeit die inneren Bindungen im Papier um, bis die Faltspannungen
verschwunden sind und der Flieger das Maximum an Formstabilität erreicht
hat.
Richtig interessant sind Foldback-Klammern allerdings
für die Lagerung von Hochleistungs-Faltfliegern. Beim Falten kommen
immer auch Spannungen ins Papier, welche dafür sorgen, das der Flieger
an den Falten wieder aufgehen möchte. Um diese Spannungen aus dem Papier
zu bekommen, sollten solche Flieger ca. eine Woche lang <nachreifen>.
In dieser Zeit bildet sich unter dem Einfluss von Druck, Temperatur und
Luftfeuchtigkeit die inneren Bindungen im Papier um, bis die Faltspannungen
verschwunden sind und der Flieger das Maximum an Formstabilität erreicht
hat.
Foldback-Klammern gibt es in vielen verschiedenen Größen. Üblich sind Maulbreiten von 13 / 16 / 19 / 25 / 32 / 41 / 51 mm.
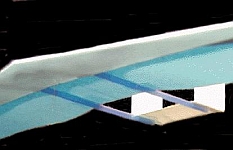
 Papierflugzeuge,
in welchen Trinkröhrchen verbaut werden, sind echte Exoten. Allerdings
ist dieses Baumaterial billig und leicht verfügbar. Es birgt daher ein
gewisses Potential, welches gehoben werden will. Leider werden solche Flieger
von manchen Konstrukteuren nicht mehr zu den Papierflugzeugen gezählt.
Das sollte aber jeder für sich entscheiden. Schließlich hängt
das von der Definition eines Papierflugzeuges ab. Wie viel Gewichts- oder
Volumenprozent dürfen aus einem anderem Material als Papier bestehen?
Tja ich weiß das nicht, und ob das Ding am Ende Papier- oder Modellflieger
heißt, ist mir eigentlich auch herzlich egal.
Papierflugzeuge,
in welchen Trinkröhrchen verbaut werden, sind echte Exoten. Allerdings
ist dieses Baumaterial billig und leicht verfügbar. Es birgt daher ein
gewisses Potential, welches gehoben werden will. Leider werden solche Flieger
von manchen Konstrukteuren nicht mehr zu den Papierflugzeugen gezählt.
Das sollte aber jeder für sich entscheiden. Schließlich hängt
das von der Definition eines Papierflugzeuges ab. Wie viel Gewichts- oder
Volumenprozent dürfen aus einem anderem Material als Papier bestehen?
Tja ich weiß das nicht, und ob das Ding am Ende Papier- oder Modellflieger
heißt, ist mir eigentlich auch herzlich egal.
 |
www.Papierfliegerei.de - Material zur Konstruktion |